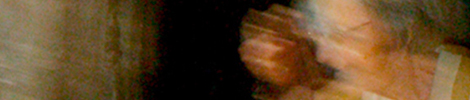Kapitel
- Erich Hezel: Leipzig – Essen – Köln – Wien – Belgrad
Inhaltsverzeichnis
Anlagen
Erich Hezel wurde am 01.01.1901 als Erich Eugen Franz Hirschfeld in der Eisenbahnstraße 31 im Leipziger Stadtteil Neustadt geboren. Er war der einzige Sohn des Arztes Dr. med. Richard Hirschfeld (1862-1942) und dessen Ehefrau Franziska Maria geborene Rosenthal (1869-1942). Die Eltern hatten bereits im Mai 1890 in Leipzig geheiratet.
1. Die Familie
Die Eltern entstammten beide jüdischen Elternhäusern und waren zu einem bislang unbekannten Datum konvertiert. In Leipzig gehörten sie seit etwa 1896 der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde an, welche von den Nachkommen der 1685 – nach der Aufhebung des Edikts von Nantes – aus Frankreich vertriebenen Hugenotten gegründet worden war.
Der Vater Richard Hirschfeld [1] entstammte einer jüdischen Familie aus Deutsch-Krone in Westpreußen. Er ließ sich 1887 als praktischer Arzt in der Leipziger Eisenbahnstraße nieder. Im Jahr 1900 gehörte er zu den Gründern des später in Hartmannbund umbenannten Berufsverbandes der Ärzte. Er wirkte über Jahrzehnte in diesem Verband als Kassierer.
Daneben pflegte er sehr intensiv seine Neigung zur Literatur. So gehörte er seit 1912 zu den Leipziger Bibliophilen [2], aber auch zu einer Gruppe literaturbegeisterter Leipziger, die sich um den Rechtsanwalt Dr. Kurt Hezel (1865-1922) sammelte. Diesem Kreis, der sich „Die Bungonen“ nannte und der sich immer donnerstags nach dem Gewandhauskonzert in einem eigenen Raum im Ratskeller zusammenfand, gehörten u. a. der Kulturmäzen Wolf Dohrn (1878-1914), der Musikwissenschaftler Hans Merian (1857-1902), der Theaterdirektor Max Martersteig (1853-1926), der Philologe Wilhelm Süß (1882-1969), derAnwalt und Präsident des Deutschen Anwaltvereins Martin Drucker (1869-1947), der Jurist und Schriftsteller Kurt Martens (1870-1945), der Literaturwissenschaftler Georg Witkowski (1863-1939), der Regisseur Alwin Kronacher (1880-1953), der Anwalt und Bühnenautor Hans Bachwitz (1882-1927), der Mathematiker und Philosoph Felix Hausdorff (1862-1942) [3], der Schriftsteller und Kaufmann Gustav Hermann, der Ökonom Erwin von Beckerath (1889-1964), aber auch Hirschfelds Berufskollegen Dr. Ernst Eggebrecht (1864-1953), der Psychiater Dr. Rudolf Götze (1863-1920) und der Frauenarzt Dr. Adolf Rauscher (geb. 1873) an. Während ihrer Leipziger Zeit, waren auch die Schriftsteller Richard Dehmel (1863-1920) und Frank Wedekind (1864-1918) Gäste des erlauchten Kreises. [4] Die Bungonen lebten von und durch Kurt Hezel und mussten deshalb mit dessen Tod 1921 ebenfalls ein jähes Ende finden. Einige dieser Freunde des Vaters haben die spätere Entwicklung des Sohnes Erich entscheidend beeinflusst.
Während seines Jura-Studiums wohnte auch Heinrich Hirschfeld, ein fünf Jahre jüngerer Bruder des Vaters, in Leipzig. Auch er war konvertiert und Mitglied der evangelisch-reformierten Kirche. Heinrich Hirschfeld heiratete 1908 in Berlin Meta geborene Schoenfeld, die sich zu dieser Zeit noch zum jüdischen Glauben bekannte. Er war Rechtsanwalt in Deutsch-Krone. Seine Witwe lebte seit etwa 1935 als Hausdame in Leipzig. [6] Meta Hirschfeld (1882-1943) wurde am 21.01.1942 nach Riga deportiert und von dort schließlich am 02.11.1943 ins KZ Auschwitz, wo sie umgebracht wurde. [6]
Die Familie der Mutter stammte aus Kassel. Deren Eltern lebten aber schon längere Zeit in Leipzig. Der Kaufmann Moritz Rosenthal (1836-1907) und seine Frau Anna geborene Meyer (1848-1935) gehörten bis zu ihrem Lebensende der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig an. Ihre Gräber befinden sich auf dem Alten Israelitischen Friedhof in der Berliner Straße.
Die Familie lebte 1920 kurzzeitig in Borsdorf. Die Gründe dieses vorübergehenden Umzuges sind allerdings noch unklar. [7]
Richard Hirschfeld starb am 18.03.1942 in Leipzig. Franziska Hirschfeld kam vom 05.11.1942 bis 26.02.1942 wegen „Verbreitung einer Hetzschrift“ in Haft. Sie hatte den Text der Predigt von Clemens August Graf von Galen, Bischof zu Münster, vom 13.04.1941 und andere regimekritische Schriften verbreitet. Ihr Name stand auf der Deportationsliste für den 19.09.1942. Da Franziska Hirschfeld am 01.09.1942 starb, wurde ihr Name gestrichen.
Da die Eltern nach 1933 von den Nationalsozialisten als Juden behandelt wurden, hatten sie sich von der evangelisch-reformierten Kirche entfernt. Das sie allerdings von der Kirchgemeinde „ausgeschlossen“ wurden, ist nicht belegt. [8]
Die Eheleute lebten die letzten Jahre getrennt [9], waren aber nicht geschieden. Richard Hirschfeld war im Altersheim in der Auenstraße (heute Hinrichsenstraße) [10] untergebracht und seine Frau in der Färberstraße. [11] Über die Gründe diese Trennung ist nichts bekannt. Beide wurden in getrennten Gräbern [12] auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Leipzig beerdigt.
2. Die Taufe
Erich Hezel [13] wurde am 25.03.1901 in der Wohnung der Eltern getauft. Wie alle Eltern wählten sie die Taufpaten für ihren Sohn sicher mit großer Sorgfalt aus. Schließlich sollen die Paten Verantwortung für das Kind übernehmen, insbesondere dann, wenn die Eltern einmal nicht in der Lage seien sollten, für das Kind zu sorgen. Die Auswahl der Taufpaten gewährt insofern einen Einblick in den engsten Freundeskreis, da wegen des Glaubenswechsels keiner der Paten aus dem jüdischen Familienkreis kam. Die Taufpaten waren nach dem Taufeintrag in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde: Herr Hugo Graf, Fabrikbesitzer in Leipzig, reformiert; Frau Eugenie Demuth, Wien, lutherisch und Frau Franziska Weigel, Leipzig, lutherisch. [14]
Hugo Graf
Der Kaufmann Georg Hugo Graf (1866-1941) stammte aus Königsberg und kam 1891 nach Leipzig. Zuvor hatte er mehrere Jahre in London und Paris gearbeitet. [15] Hier wurde er Mitinhaber der 1871 im Leipziger Süden gegründeten Firma F. Harazim, Glacé-, Carton und Cromo-Papierfabrik, später der Vorstand der F. Harazim Papierhandel AG. Wie der Taufeintrag belegt, war auch er Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Er war Vorstandsmitglied der Freisinnigen Volkspartei Leipzig, die ihn 1912 auch als Kandidat für die Reichstagswahl aufstellte. 1919 gehörte er dem Vorstand der Deutschen Demokratischen Partei für Leipzig und Umgebung an.
Seine Ehefrau, Sophie Amalie geborene Hirsch (* 1872), war jüdischer Herkunft. Ihr Vater war der Redakteur (Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft), Schriftsteller und Privatgelehrte Dr. phil. Franz Wilhelm Hirsch (02.05.1844 Thorn – 19.07.1920 Berlin). Er gehörte bis 1885 dem Vorstand des Allgemeinen Deutschen Schriftstellerverbandes mit Sitz in Leipzig an. Die Mutter war Charlotte geb. Borchardt (1847-1921) aus Königsberg. Das Ehepaar hatte noch einen Sohn, Albrecht Franz Benedict Hirsch (* 31.12.1869 in Leipzig)
Sophie Hirsch wurde gleich nach Ihrer Geburt in der evangelisch-reformierten Kirche getauft, da bereits die Eltern vor ihrer Heirat konvertiert waren. Die sich hieraus ergebenden vergleichbaren Lebenserfahrungen waren vermutlich eine der Wurzeln für die Freundschaft zwischen den Familien Hirschfeld und Graf. Sophie Graf „nannte man die Rote Gräfin, weil sie bei ihren Ausfahrten ein Kleid von demselben weinroten Tuch zu tragen pflegte, womit die Polster ihrer Equipage bezogen und woraus der Mantel und die Livree ihres Kutschers gefertigt waren.“ Wie der Rechtsanwalt Kurt Hezel soll sie an Kyklothymia, einem „manisch-depressiven Irresein“ gelitten haben. [16]
Hugo Graf bot aber auch aufgrund seiner sehr guten Vermögensverhältnisse die Gewähr dafür, dass er die Verpflichtungen einer solchen Patenschaft erfüllen kann. Dass er diese zusätzliche Verantwortung übernahm, ist aber trotzdem sehr bemerkenswert, weil er selbst zu dieser Zeit bereits drei Söhne hatte.
Aus einem ganz anderen sozialen Umfeld kamen die Taufpatinnen. Sie waren beide Schauspielerinnen am Königlichen Schauspielhaus in Berlin gewesen. Seit dieser Zeit waren sie vermutlich Freundinnen, denn sie kamen später beide nach Leipzig an das Alte Theater. Doch zuvor standen sie am 11.05.1892 in der Inszenierung „Doctor Claus“ von Adolph L’Arronge in Wien während der Internationalen Ausstellung für Musik- und Theaterwesen auf der Bühne.
Eugenie Demuth
Louise Adolphine Eugenie Demuth geborene Möller (1860-1954) war vor ihrer Heirat unter dem Namen Eugenie Lenau als Theaterschauspielerin bekannt. Am Königlichen Schauspielhaus in Berlin debütierte sie 1887 als Franziska in Lessings „Minna von Barnhelm“ an der Seite von Max Grube (1854-1934) als Riccaut. [17] Theodor Fontane schrieb am 21.09.1887 zu dieser Inszenierung eine Kritik. In diesem Zusammenhang wurden auch die antisemitischen Vorbehalte Fontanes deutlich. In einem Brief an seine Frau vom 21.08.1887 heißt es zu dieser Inszenierung:
„Heute Fräulein Lenau aus Wien; ich wette, dass nur die erste Sylbe richtig ist und dass sie Lewy heißt; sie spielt die Franziska, was der kl. Conrad [18] einen Stich ins Herz geben wird, denn sie (die Lenau) soll ganz gut sein.“ [19]
Für Fontane war nur eine blonde – also typisch germanische – Franziska akzeptabel. Davon hätte ihn wohl auch die Tatsache nicht abbringen können, dass Fräulein Lenau weder tatsächlich Lewy hieß, noch jüdischer Herkunft war.
Eugenie Lenau heiratete am am 07.04.1892 in Berlin (Hallesches Tageblatt vom 08.04.1892, S. 1) den späteren Wiener Kammersänger Leopold Demuth (1860-1910), der unter dem Namen Leopold Pokorny als Sohn eines Oberlandesgerichtsrats in Südmähren geboren war. Er war als Tenor zunächst in Halle und seit 1891 an der Leipziger Oper engagiert gewesen. Fünf Jahre später wechselte er nach Hamburg und von dort schließlich 1898 an die Wiener Hofoper. Ein Jahr später sang er in Bayreuth den Hans Sachs in den Meistersingern und den Gunther in der Götterdämmerung. Das Grab der Eheleute Demuth befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof.
Franziska Weigel
Henriette Christiane Franziska Weigel wurde 16.04.1847 in Braunschweig als Tochter des Chorsängers Christian Friedrich Michael Ludwig Salomon Weigel und dessen Ehefrau Elisabeth geborene Warnecke (* 22.07.1814) geboren [20]. Sie wurde am 21.05.1847 in der Kirche St. Blasius getauft. Ihre Taufpaten sind der Klempnermeister Carl Weigel aus Wolfenbüttel, Heinrich Hübner, Mühlenbesitzer und Christiane Hübner geborene Kleinert, beide aus Halberstadt. Ihr Vater ist seit 1841 am braunschweiger Hoftheater engagiert. Zu dieser Zeit ist der frühere Tenor Carl Wisender (1793-1869) nach Verlust seiner Singstimme als Inspector tätig. Seine zweite Frau ist die Musikpädagogin und Komponistin Caroline geborene Schneider (1807-1868). Für deren 1849 in Braunschweig uraufgeführte Oper „Das Jubiläum oder: Die drei Gefangenen“ verfasst Ludwig Weigel das Libretto.
Franziska Weigel ist mit dem Theaterbetrieb schon als Kind vertraut und der Vater sorgt sicher für eine fundierte musikalische Ausbildung. Am 14.11.1872 wurde sie als Schauspielerin am Stadttheater Nürnberg engagiert. Sie ist schon damals mit dem Problem des Alters für Schauspielerinnen vertraut. Wohl deshalb gibt sie ihr Alter zwei Jahre jünger an, als sie zu diesem Zeitpunkt ist. In Nürnburg debütierte sie in der Titelrolle von Eugène Scribes (1791-1861) Schauspiel „Adrienne Lecouvreur“ mit „entschiedenem Erfolg“ und als Conradine Hartenberg in dem Lustspiel des Leipzigers Roderich Benedix (1811-1873) „Die relegirten Studenten“. In einer Kritik hierzu heißt es:
„Die Eleganz ihrer Erscheinung und ein seelenvolles Spiel standen ihr auch in dieser Rolle gewinnend zur Seite. Das Publikum fühlte sich durch die ganze Vorstellung des genannten Lustspiels zu großer Heiterkeit angeregt.“ [21]
Im Dezember 1873 mus Franziska Weigel „für einen Scherz“ eine Strafe an die Genossenschaft zahlen. Im Jahr 1875 war sie als Gast aus Nürnberg am Stadttheater in Frankfurt am Main engagiert. Im gleichen Jahr ging sie an das Stadttheater nach Breslau. Im Almanach der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger für das Jahr 1876 wird sie mit der Mitgliedsnummer 2944 zwar als Schauspielerin aufgeführt, aber der Ort ihres Engagements ist mit einem Fragezeichen versehen. Für die Spielzeit 1882/83 wurde sie vom Hoftheater Darmstadt, wo ihr der Titel einer großherzoglichen Hofschauspielerin verliehen worden war, an das Residenztheater in München engagiert.
Franziska Weigel hat sich schon sehr früh für die Durchsetzung von Ibsens Dramen auf den deutschen Bühnen engagiert. Als das Augsburger Stadttheater am 14.04.1886 einen ausgewählten Kreis zu einer Generalprobe von Ibsens „Gespenster“ einlud, hatte sie die Rolle der Regina Engstrand übernommen. Zu einer Premiere der Inszenierung kam es nicht, weil die Zensur wegen der „destruktiven Tendenz“ des Stückes ein Verbot aussprach. [22] Die Generalprobe, zu welcher auch Henrik Ibsen aus München angereist war, wurde von dem Münchner Theaterkritiker Max Bernstein (1854-1925) sehr positiv besprochen: „… die Wirkung des ausgezeichneten, jeder ersten Bühne würdigen Spieles … der Damen Weigel und Hausen waren so ergreifend und erschütternd, wie sie in einem modernen Theater sehr selten erlebt wird.“ [23]
In den Jahren 1891/92 spielte sie am Königlichen Schauspielhaus in Berlin, u. a. am 18.11.1891 die Sophie Guilbert in Goethes „Clavigo“ und am 16.12.1891 den bösen Geist in Goethes „Faust“. Ihre Freundin Eugenie Lenau spielte in dieser Inszenierung die Hexe. Im Jahr 1895 spielt sie die Oberpriesterin der Diana in Kleists „Penthesilea“.
Ende 1895 ist sie am Deutschen Volkstheater in Wien engagiert. Vor dort kommt sie in diesem Jahr zunächst als Gast nach Leipzig ans „Neue Theater“, wo sie die Rolle der Elisabeth in Mortimers „Maria Stuart“ übernimmt, mit welcher sie bereits in Wien debütiert hatte.
Franziska Weigel war seit 1896 am Leipziger Stadttheater engagiert, wo sie am 05.12.1896 die Frau Publia in der Uraufführung von Henrik Ibsens „Kaiser und Galiläa“ spielte. Der namhafte Leipziger Literaturkritiker dieser Zeit Rudolf von Gottschall (1823-1909) bescheinigte ihr, dass sie ihre kurze pathetische Szene wirksam dargestellt habe. [24] Ein Jahr später übernahm sie die Rolle der Miss Lona Hessel in Ibsens Drama „Stützen der Gesellschaft“.
Im Leipziger Adressbuch ist sie unter der Wohnanschrift Frankfurter Straße 5/II, also in unmittelbarer Nähe zum Alten Theater, verzeichnet. Im Jahr 1898 wird ihr Beruf mit Schauspielerin angegeben und von 1899 bis 1902 wird sie als Mitglied des Stadttheaters bezeichnet. Dieses Engagement scheint dann beendet gewesen zu sein, denn 1903/04 erscheint ihr Name im Adressbuch ohne eine Berufsangabe. Ab 1905 wird sie unter unveränderter Wohnanschrift als „dram. Lehrerin“ aufgeführt, seit 1910 nur noch als Privata.
Franziska Weigel war Vorstandsmitglied der Ortsguppe Leipzig des Schillerverbandes deutscher Frauen, die sich 1901 gegründet hatte.
Der letzte Eintrag aus dem Jahr 1916 nennt sie als „Pensionärin d. Stadttheaters“. Franziska Weigel blieb unverheiratet. Sie starb im Alter von 69 Jahren im Februar 1916 in Leipzig (Sächsische Staatszeitung vom 25.02.1916, S. 4).
3. Das Nikolai-Gymnasium
Erich Hezel wurde Ostern 1911 nach bestandener Aufnahmeprüfung in das Nikolai-Gymnasium in die Sexta a aufgenommen. Welche Schulbildung er zuvor genoss, ließ sich bislang nicht feststellen. Richard Wagner gehörte zu den namhaften Schülern der angesehenen ältesten Bürgerschule Leipzigs.
Der Schriftsteller Hans Reimann (1889-1969) schreibt dagegen über seine Zeit an dieser Schule: „Ich hingegen wuchs in Leipzig auf, wo der Brühl üppige Blüten trieb (und treibt!), ‚besuchte‘ das Nikolai-Gymnasium und erlernte daselbst – neben toten Sprachen, zu denen auch Deutsch gezählt ward – den Antisemitismus. Alljährlich erschien, vom Rektor der Anstalt herausgegeben, ein Schülerverzeichnis. In diesem Schüler-Verzeichnis taten sich gewissen Kopennäler durch eine Klammer hervor, die hinter ihrem Namen stand. Durch die Klammer: (i). Und das hieß: israelitisch. Es war ihnen also ein Merkmal aufgebrummt, das etwa ähnliche Wirkung zeitigte, wie sie der Zusatz „republikanisch“ bei Individuen zeitigt, die unter strammen Monarchisten ihr Wesen treiben.“ [25]
Dieser Namenszusatz erfolgte offenbar nur bei Schülern, deren Eltern Mitglieder der Israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig waren. Erich Hezel war von einer solchen öffentlichen Brandmarkung folglich nicht betroffen. Dass er sich aber trotzdem selbst als Jude sah und als solcher wohl auch von Dritten angesehen wurde, belegen die Erinnerungen von Axel Eggebrecht.
Obwohl das Nikolai-Gymnasium zahlreiche Kinder von Juden besuchten, war in der Klasse von Erich Hezel kein einziger jüdischer Mitschüler und offenbar auch keiner, dessen Eltern konvertiert waren.
Die alljährlich erscheinenden Berichte über den Verlauf des Schuljahres dokumentieren, das sehr frühe Interesse von Erich Hezels am Gedichtvortrag und dem Theater. Als am 17.12.1912 in der Schulaula vor Mitschülern, Lehrern und Eltern Vorträge unter dem Motto „Hans Sachs und seine Zeit“ angesagt waren, trug er das Gedicht „Der Schmied mit den bösen Zähnen“ von Hans Sachs vor. Sein Mitschüler Arthur Ehrenberg [26] rezitierte das Schlaraffenlied.
Eine Initialzündung für die lebenslange Begeisterung für das Theater dürfte aber ein Jahr später die Inszenierung von Schillers Räubern anlässlich der 400-Jahrfeier des Nikolai-Gymnasiums gewesen sein. Der damalige Schauspieler am Städtischen Theater Walther Brügmann studierte dieses Stück mit den Schülern ein. Die Premiere fand am 22.05.1912 im historischen Goethetheater in Lauchstedt statt. Die Begeisterung unter allen Schülern muss enorm gewesen sein. Als besonders bewegend wird die Darstellung des Franz Moor durch Werner Teupser [27] beschrieben. Am Schluss der Vorstellung drohte das gebrechliche Theater unter dem Beifall der Hörer zusammenzubrechen.
Die Hauptrollen mussten wohl den älteren Schülern vorbehalten bleiben. Aber der 11jährige Erich Hezel war mit Sicherheit bei den Massenszenen mit auf der Bühne. Die erfolgreiche Inszenierung wurde am 06.06.1912 im Alten Theater in Leipzig wiederholt.
Ein Jahr später schon wird der Name Erich Hezel auf einer Besetzungsliste genannt. Am 09.12.1913 wird im Theatersaal des Krystallpalastes „Peter Squenz“ das Schimpfspiel von Andreas Gryphius in der Regie von Eugen Zadeck [28] vom Leipziger Theater aufgeführt. Erich Hezel spielte den Meister Kipperling, den Tischler und den Löwen. Die Titelrolle hatte sein Schulkamerad Arthur Ehrenberg übernommen, der also gleichartige Interessen hatte. Ob die beiden befreundet waren, lässt sich bislanf nicht belegen. Aber vieles spricht dafür, dass er zu dem Kreis literaturbegeisterter Schulkameraden gehörte, die Erich Hezel schon frühzeitig um sich scharte.
Axel Eggebrecht
In der Literatur wird verschiedentlich behauptet, dass Erich Hezel die Thomasschule besucht habe. [29] Das wird irrig aus seiner engen Freundschaft mit Thomasschülern, insbesondere Hellmut Köster (1898-1963) [30] und Axel Eggebrecht (1899-1991), dem Sohn des Arztes Ernst Eggebrecht, geschlossen. Die Erinnerungen von Axel Eggebrecht [31]geben einen tieferen Einblick in die Lebenssituation der Freunde während ihrer Schulzeit, denn die Beiden waren immer in einer losen Verbindung geblieben.
Axel Eggebrecht schreibt dazu in seinen Erinnerungen:
„Durch Erich kam ich in eine Runde jugendlicher Literaturbeflissener. Neuromantik war Trumpf, der Geschmack sehr unsicher, Stefan George und Anton Wildgans wurden gleichermaßen gefeiert, Caesar Flaischlein galt so viel wie Rainer Maria Rilke.“ [32]
Leider geben die Erinnerungen keinen Hinweis, wie sich die beiden Freunde kennen gelernt haben. Schließlich konnte es zwischen Thomasschülern und Nikolaischülern kaum einen größeren Unterschied geben, wie Eggebrecht selbst schreibt:
„Das Nicolai-Gymnasium lag in einem entfernten östlichen Stadtteil. Es hatte keine imposante Geschichte, seine Schüler wurden von Thomanern als mindere Gattung betrachtet. Zumeist waren es Kinder aus kleinbürgerlichen Familien, es gab auch Proletariersöhne, was in den höheren Schulen selten war.“ [33]
Genau an diese Schule musste Axel Eggebrecht aber wechseln, als er von der Thomasschule wegen diverser Diebstähle relegiert worden war. Da er dort einen Jahrgang niedriger eingestuft wurde, könnte er folglich mit Erich Hezel in eine Klasse gegangen sein. Die Freundschaft kann also damals entstanden sein. Allerdings durfte Axel Eggebrecht schon nach kurzer Zeit wieder zurück an die Thomasschule.
Die Freunde können sich aber auch durch ihre Väter kennengelernt haben, die sich als Berufskollegen, aber wohl vor allem durch ihre gemeinsame Mitgliedschaft bei den Bungonen, kannten. Hiergegen spricht, dass sich die Beziehung der beiden offenbar nicht auf die Eltern erstreckte.
Erich Hezel muss frühzeitig Klavier- und vermutlich auch Gesangsunterricht erhalten haben. Er wurde sehr bald zu einem enthusiastischen Wagner-Verehrer. Er spielte als 13jähriger seinen Freunden stundenlang Klavierauszüge von Wagners Opern vor und beeindruckte sie sogar durch die eindrucksvolle Markierung der Gesangsstimmen. [34] Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass sich die Freunde in der elterlichen Wohnung von Erich Hezel trafen, denn nur dort wird ein Klavier zur Verfügung gestanden haben.
Die Erinnerungen von Axel Eggebrecht gewähren darüber hinaus einen bemerkenswerten Einblick in das wechselseitige Verhältnis zum Judentum der beiden Freunde:
„Die Wagner-Verehrung war gerade in jüdischen Kreisen verbreitet. Daß Erich Jude war, zog mich auf unbestimmbare Weise an, was er selber lächerlich fand. Durch ihn erfuhr ich, daß es Antisemitismus gebe, den ich in aller Unschuld als unwichtige Albernheit ansah. Ihn bedrückte die Sache insgeheim erheblich, in späteren Jahren mußte ich ihm recht geben, wir blieben immer in lockerer Verbindung“
Die selbstverständliche Annahme, dass Erich Hezel Jude war, steht im faktischen Widerspruch dazu, dass er bereits nach seiner Geburt getauft wurde und auch die Eltern schon längst konvertiert waren. Das änderte aber offensichtlich nichts daran, dass er von anderen als Jude wahrgenommen wurde und auch Hezel selbst seine Verbindung zum Judentum durch die Taufe nicht als abgebrochen ansah. Diesbezüglich ging es ihm nicht anders wie vielen Zeitgenossen aus konvertierten Familien. [35] Anderen Familien dagegen gelang es, bis 1933 ihre jüdischen Wurzeln zu verdrängen, wie das Beispiel von Eggebrechts Schulfreund Walter List belegt, der aus der Familie des namhaften List-Verlages entstammte.
Freundschaften zu Juden waren auch für Axel Eggebrecht eine absolute Ausnahme, obwohl er – wie auch sein Vater – dem aufkommenden Antisemitismus mit Abscheu begegnete. So spricht sehr viel dafür, dass dieses Gedicht Eggebrechts aus seiner Gymnasialzeit die Gefühlswelt seines Freundes Erich Hezel widerspiegelte:
Der junge Jude
Da ich mir heißer fluchte, als je ein Mensch sich geflucht,
kann ich mich tiefer erst lieben, da inniger ich mich gesucht.
Und schwillt der Haß gegen uns reißender übers Land,
bleibt um so schmerzlich süßer Freundschaft, die ich selten fand.
Träum‘ ich, wie man der schmetternden Tage Frohlocken
um ihre Schalheit in aller Fülle betrog, fühl‘ ich mich nur noch
ein schmutziger Flocken,
der an die weiße Säule hellerer Völker flog.
Aber klärt sich über ihren ausbrünstigen Nächten
meine Hoffnung, selbst noch wirr und beengt,
dann spür‘ ich den Wert meines Seins noch in dunkelsten Schächten,
Körnlein Gold, ins elende Quarz eingesprengt.
Traumdurchwälzte Lager ahnen meine Vernichtung
Graut die Frühe: Der Zweifel starrt, ungelöst,
ob wir jene köstlich-fünffache Verdichtung
oder ein Tropfen Gift, an dem die Menschheit verwest … [36]
Dieses Gedicht erschien im Juni 1920 als bibliophiler Druck in der Offizin Poeschel & Trepte in nur 30 Exemplaren unter dem schlichten Titel „Gedichte“. [37]Es ist ein einzigartiger Beleg dafür, wie stark Erich Hezel schon während seiner Schulzeit seine trotz Taufe fortwährende Bindung zum Judentum empfand. Er dürfte mit diesen Gefühlen der Zerrissenheit nicht allein gewesen sein.
4. Studium und Promotion
Erich Hezel studierte in Leipzig von April bis August 1920 zunächst Germanistik und zuletzt vom 05.05.1922 bis 10.01.1924 Jura. Zwischenzeitlich hatte er in Berlin vom 27.10.1921 bis 16.03. 1922 und im Wintersemester 1920/21 in München Jura studiert.
Er beendete seine juristische Ausbildung mit seiner Promotion in Leipzig. Das Thema seiner Dissertation lautete „Schauspieler und Film“. Die 74 Seiten umfassende Arbeit ist als Maschinenschrift in der Universitätsbibliothek Leipzig überliefert. Sie beginnt mit der Widmung: „Meinen Eltern in Dankbarkeit“.
Erich Hezel befasst sich darin mit einem praktischen Problem, welches durch die rasante Entwicklung des Tonfilms entstanden war: Dürfen Theaterschauspieler neben ihrem Engagement an einem Theater gleichzeitig Verpflichtungen für eine Filmproduktion eingehen? Dabei geht es nicht nur um mögliche zeitliche Überschneidungen, sondern auch um die Frage, ob das Theater einen Anspruch darauf hat, dass der Schauspieler abends zur Vorstellung „ausgeruht“ erscheint. Die Praxisnähe der Darstellung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vorgelegte Arbeit nur sehr bedingt wissenschaftlichen Ansprüchen genügen kann. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Dissertation nur mit der Note „rite“ (genügend) bewertet wurde.
Nach erfolgreichem Abschluss der Promotion am 16.05.1924 hat sich Erich H. nicht für die freiberufliche Anwaltslaufbahn entschieden. Durch den drei Jahre zuvor verstorbenen Freund der Eltern, Kurt Hezel, hatte er vermutlich eine sehr klare Vorstellung wie der Berufsalltag eines Anwalts aussieht. Er wusste aber dadurch auch, wie problematisch die lebenslange Diskrepanz zwischen dem Anwaltsberuf und künstlerischen Ambitionen sein kann. Es gibt in der Justizgeschichte zahlreiche Beispiele für Juristen mit künstlerischer, insbesondere literarischer Begabung. Sie haben sich entweder, wie das bekannteste Beispiel Goethe zeigt, für die Literatur entschieden. Oder sie haben, wie Kurt Hezel, am Anwaltsberuf festgehalten. Erich H. hat aber in seinem unmittelbaren Freundeskreis auch erlebt, dass eine Entscheidung für die Kunst erfolgreich möglich ist. Dieses Vorbild könnte für Erich H. der Regisseur Dr. Alwin Kronacher gewesen sein.
Sicher war diese Lebensentscheidung sehr lang und sorgfältig überlegt. Leider ist nicht überliefert, wie seine Eltern zu dieser Entscheidung standen. Aber der Vater Richard Hirschfeld dürfte sehr gut verstanden haben, dass sich sein Sohn letztendlich für die Kunst entschied.
Bemerkenswert ist, dass sich Erich H. für einen Berufsweg entschied, der hinsichtlich seines Status seine Lebenserfahrung – wie die aller konvertierten Juden – sehr gut widerspiegelt: Der Regisseur steht in der Hierarchie zwischen den Theaterleitern und den Schauspielern. Er gehört weder zu dieser noch zu jener Gruppe. Genauso hat Erich H., der trotz seiner Taufe immer als Jude wahrgenommen wurde, seine Lage schon als Schüler erlebt.
Erich H. hatte sich schon vor 1924 verschiedentlich dem Theater zugewandt. So ist er 1923 als Schauspieler im Alten Theater nachweisbar. Dass er allerdings drei Jahre in Leipzig als Schauspieler gearbeitet haben soll, wie in einer Broschüre über den Belgrader Bühnenbildner Stanislav Belozinski behauptet wird [38], konnte nicht belegt werden. Diese Tätigkeit hätte er nur neben dem Studium ausüben kann, was aber nicht unmöglich erscheint.
Eine Fußnote eines Aufsatzes in den „Leipziger Bühnenblättern“ gibt darüber hinaus Aufschluss, dass sich Erich H. auch schon vor 1924 mit Opernregie befasst haben muss. Der von ihm verfasste Aufsatz enthält folgenden Hinweis: „Der aus der Schule von Operndirektor Brügmann hervorgegangene Oberspielleiter des Stadttheaters Essen, Herr Dr. Erich Hezel, hat uns diesen Aufsatz liebenswürdigerweise zum Abdruck überlassen.“ [39]
Der in Leipzig geborene Walther Brügmann war 1924 von Frankfurt am Main als Operndirektor nach Leipzig gekommen. Hier sorgte er sehr bald mit seinen Inszenierungen von Ernst Kreneks „Johnny spielt auf“ und Brecht/Weills „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ für großes Aufsehen weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Ausweislich der Einwohnermeldekartei hatte sich Erich H. am 28.05.1920 nach Frankfurt am Main abgemeldet, am 15.08.1921 meldete er sich dann nach München ab, um dort sein Studium fortzusetzen. Er kann also nur in diesem Zeitraum bei Walther Brügmann in Frankfurt am Main gearbeitet haben. Wie die Ausbildung bei ihm genau aussah, lässt sich bislang mangels Quellen nicht genauer beschreiben. Sein Verständnis von Opernregie hat Erich Hirschfeld klar und selbstbewusst in dem Aufsatz in den Leipziger Bühnenblättern, insbesondere unter Berufung auf den russisch-sowjetischen Regisseur Alexander Tairow (1885-1950), dargelegt.
5. Der Künstlername
Es gibt widersprüchliche Angaben, dazu wann und wie Erich Hirschfeld seinen Familiennamen in Hezel änderte. Sein Freund Axel Eggebrecht schreibt in seinen Erinnerungen, dass er nach dem Tod seines Vaters von Kurt Hezel adoptiert worden sei. Das habe ihm sein Freund Erich so erzählt. Diese Angabe kann aber so nicht stimmen, denn der Vater starb erst 1942, während Kurt Hezel zwanzig Jahre vor ihm gestorben war. Es gibt auch keine Hinweise, dass es jemals eine amtliche Namensänderung gegeben haben könnte.
Diese Angaben könnten auf ein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater hindeuten, da Erich H. ihn zu seinen Lebzeiten für tot erklärt. Ob es zu Auseinandersetzungen gekommen war, weil Erich sich nach Abschluss seiner aufwändigen juristischen Ausbildung dem Theater zuwandte, erscheint wenig wahrscheinlich. Dagegen spricht, dass Richard Hirschfeld selbst ein sehr enges Verhältnis zu Theater und Literatur hatte. Leider gibt es keinerlei Hinweise wie intensiv die Verbindung von Erich H. zu seinen Eltern war, nachdem er seine Heimatstadt verlassen hatte. Es kann bislang nicht einmal belegt werden, ob er jemals – zumindest besuchsweise – wieder zurückkehrte.
Dass Erich H. den Namen des Freundes seines Vaters für seine Theaterarbeit benutzte, muss den Eltern aber bekannt gewesen sein. Denn als am 19.09.1923 im Leipziger Alten Theater unter der Regie von Dr. jur. Alwin Kronacher (1880-1951), ebenfalls ein aktiver Bungone und Freund des Vaters, die in die Theatergeschichte eingegangene Uraufführung von Ernst Tollers (1893-1939) „Hinkemann“ stattfand, stand auf der Besetzungsliste unter den Darstellern Erich Hezel als der Flammenwerfer [40].
Erich H. benutzte den Namen Hezel offensichtlich nur als Künstlernamen. Die Beweggründe für diesen Namenswechsel lassen sich heute nicht mehr mit absoluter Sicherheit aufklären. Eine denkbare Auslegung könnte sein, dass Erich H. für seine öffentliche Bühnenkarriere den jüdischen Namen Hirschfeld vermeiden wollte.
Den Familiennamen des Freundes seines Vaters nahm er aber mit Bedacht an, denn das Verhältnis zu Kurt Hezel muss ein ganz besonders enges gewesen sein. Der literaturafine, hochbegabte, aber auch sehr exzentrische Leipziger Rechtsanwalt Hezel gehörte bis zu seinem Tod zu den namhaftesten Vertretern seines Berufsstandes. In einem Nachruf in der Juristischen Wochenschrift heißt es über ihn: „Hezel war der Mittelpunkt, jedenfalls der juristische Mittelpunkt, des künstlerischen Deutschland. Seit jungen Jahren zählte er zu den Vertrauten des Haus Wahnfried, war der intime Freund Otto Erich Hartlebens, Richard Dehmels und nicht zuletzt Frank Wedekinds, der ihm sein letztes Werk, die Tragödie Herakles gewidmet und ihm schon früher in einer seiner dramatischen Gestalten ein Denkmal gesetzt hat.“ [41]
Kurt Hezel starb 56jährig unverheiratet und ohne Nachkommen am 21.12.1921 in Leipzig. Er hatte bereits am 06.03.1909 ein handschriftliches Testament aufgesetzt, in welchem er seine Geschwister zu gleichen Teilen als Erben einsetzte.
Unter § 4 der letztwilligen Verfügung heißt es dann wörtlich: „Dem Sohne des mir befreundeten Ehepaares Herrn Dr. med. Richard Hirschfeld und Frau Franziska Hirschfeld geb. Rosenthal, Herrn[42] Erich Hirschfeld, setze ich ein Vermächtnis von 12000.—M aus.“[43] Das war eine sehr beachtliche Summe zu dieser Zeit, welche Erich Hirschfeld sicher eine materielle Basis gab, um seinen beruflichen Ambitionen ohne Rücksicht auf Einkommenschancen zu verfolgen.
Der Freundeskreis von Kurt Hezel war beachtlich. Unter diesen befanden sich auch zahlreiche Ehepaare mit Kindern, hierzu gehörte z. B. sein Anwaltskollege Martin Drucker (1869-1947). Warum der kinderlose Hezel ein so beachtliches Vermächtnis ausgerechnet für Erich H. aussetzte, wird sich nicht mehr mit Bestimmtheit aufklären lassen.
Man kann aber sicher ohne weiteres davon ausgehen, dass Erich H. für diese materielle Absicherung sehr dankbar war. Inwieweit Hezel hinsichtlich seines Charakters und seines Lebensstils ein Vorbild für den jungen Erich sein konnte, bleibt allerdings mehr als fraglich.
Dass Erich H. unter dem Druck der Verfolgung später Kurt Hezel, der im Sinne der Rassenideologie der Nationalsozialisten „arisch“ war, als seinen leiblichen Vater angab, ist mehr als verständlich. Der Unterschied zwischen einem „Volljuden“ und einem „Halbjuden“ konnte in dieser Zeit über Leben und Tod entscheiden. Es gibt für die Zeit der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten etliche vergleichbare Fälle, in denen jüdische Mütter zum Schutz ihrer Kinder behaupteten, dass der leibliche Vater ein „Arier“ gewesen sei. In den meisten dieser Fälle waren aber die vermeintlichen und die tatsächlichen Väter bereits tot, so dass eine Überprüfung dieser Angaben nicht möglich war. Hilfreich für Erich H. seine Version aufrecht zu erhalten war, dass diese von Belgrad aus nur schwer wiederlegbar war und er den Namen Hezel schon so lange Zeit führte.
Erich H. konnte aber wohl auch davon ausgehen, dass unter dem Druck der Verfolgung die in Leipzig lebenden Eltern seine Version bezüglich der Vaterschaft bestätigen würden, um ihn zu schützen. Ungeklärt bleibt leider auch, ob Erich H. von der Erkrankung seines Vaters und dem Tod seiner Eltern im Jahr 1942 überhaupt noch erfahren hat. Die Kommunikation zwischen Leipzig und Belgrad war zu dieser Zeit sicher außerordentlich schwierig und auch gefährlich.
6. Berufliche Laufbahn bis 1933
6.1. Städtische Bühne Essen
Erich H. meldete sich am 25.08.1925 von Leipzig, wo er bis zuletzt bei den Eltern gemeldet war, nach Essen ab. Am dortigen Theater trat er ein Engagement an. Ab dieser Zeit ist er dann nur noch unter dem Namen Hezel nachweisbar. Leider konnte nicht ermittelt werden, auf welche Weise Erich H. sein erstes Engagement als Opernregisseur bekam. Ohne eine Empfehlung dürfte das nahezu unmöglich gewesen sein.
In Essen wurde Erich H. an dem 1892 eröffneten Stadttheater schon 1926 zum Oberspielleiter für die Oper ernannt[44]. Der Intendant des Stadttheaters war seit 1921 Stanislaus Fuchs (1864-1942), der musikalische Leiter Felix Wolfes (1892-1971). Hier arbeitete er mit dem namhaften Bühnenbildner Hein Heckroth (1901-1970) zusammen, der später als Filmausstatter zu Weltruhm gelangte. Für seine Inszenierung der Antigone entwarf Caspar Neher (1897-1962) das Bühnenbild, der insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit Bert Brecht in die Theatergeschichte eingegangen ist.
Die Zeit in Essen erscheint in der Rückschau für Erich H. ausgesprochen fruchtbar und erfolgreich. Es sind für die Zeit bis 1929 insgesamt zehn Inszenierungen nachweisbar. Neben einigen klassischen Opern wurden vor allem neuere Werke aufgeführt. Die Zusammenarbeit mit Felix Wolfes, insbesondere die Verständigung zum Programm scheint problemlos gewesen zu sein. Daran änderte sich auch nichts, nachdem 1927 als weiterer Spielleiter für die Oper Carl Johann Perl (1891-1979) engagiert worden war. Nach dessen Ausscheiden trat Wolf Völker[45] (1896-1984) in diese Position ein, der dann 1934 zum Oberspielleiter ernannt wurde.
Eine geradezu euphorische Besprechung gab es von A. Rohlfing zur Inszenierung von Hindemiths Antigone:
„Die Essener Spielleitung (Erich Hezel) hatte sich bemüht, dem wuchtigen Charakter, dem Tempo und der Atmosphäre des seltsamen Werkes Rechnung zu tragen. Sie hatte in der Ausstattung (Kaspar Neher), der Kostümierung und dem sonstigen szenischen Drum und Dran dem Stück jenes vorklassischen Griechenlands, das wir aus erhaltenen Masken tragischer Schauspieler, Vasenbildern und Wandgemälden kennen und das dem Dichter und dem Komponisten vor Augen schwebte, treffen wollen.“
Und weiter:
„Alles in allem ein großer Tag für die Essener Oper, in die mit der Leitung Schulz-Dornburgs ein stärkerer Wille zur Bejahung des Modernen eingezogen ist. Ob die Antigone ihren Weg nehmen wird? Ob spätere Geschlechter sich zu dieser Musik bekennen werden? Wir lassen diese Frage offen, erinnern aber an die Ablehnung der Straußschen „Elektra“ vor 20 Jahren, die heute ein so selbstverständlicher Besitz der neuesten Operngeschichte ist. Ob aber zukunftsreich oder nicht, jedenfalls ist die Honeggersche Musik in stärkster Weise Zeitausdruck und als solcher von einer Bedeutung, die ihr kein Unvoreingenommener abstreiten wird.“[46]
Zur Inszenierung von Hindemiths „Cardillac“ schreibt der Kritiker Rolf Cunz: „Hezels Spielleitung verdient hohe Anerkennung, besonders was die einheitliche Disziplinierung der Mitwirkenden und die Ökonomie der Lichtuntermalung sozusagen partiturgetreu betraf.“ [47]
Das Essen Theater litt allerdings zu dieser Zeit – wie viele andere deutsche Theater – unter defizitären Verhältnissen. Das Deutsche Bühnen-Jahrbuch erschien für das Jahr 1930 mit einer Deutschlandkarte im Anhang, welche die Situation der deutschen Theater verdeutlichte. Hierin wird das Stadttheater als gefährdet eingestuft.
Im Jahr 1928 beteiligte sich Erich H. an einer Umfrage in der Zeitschrift „Die Scene“ zum Thema „Kapellmeister und Opernregie“. Die Zeitschrift der Vereinigung künstlerischer Bühnenvorstände (VKB) druckte daneben auch die Meinungen von Walther Brügmann, Gustav Brecher und Ernst Kreneck zu diesem Thema ab.
Erich H. äußerte sich wie folgt:
»Die Opernaufführung wird bestimmt durch gemeinsame Arbeit von Kapellmeister und Regisseur. Gemeinsamkeit ist geeinte Kraft zu gleichem Ziele. Einigkeit ist vorheriges Wissen um den Willen des Anderen bis ins Kleinste, sich beugen können, die eigene Kraft am Anderen steigern, ihn ergänzen. Das Ziel heißt tiefstes Erfassen des Werkes und höchste Vollendung der Wiedergabe. Nicht immer gelingt diese Gemeinsamkeit. So ist es verständlich, daß der Kapellmeister, der die unanfechtbare, langer anerkannte und somit leichter durchführbare Aufgabe im Opernbetrieb hat, die Einheitlichkeit der Aufführung durch die Vereinigung der szenischen und orchestralen Leitung in seiner Person zu erreichen sucht. Doch liegt in diesem Einswerden zugleich ein Eindämmen. Es heißt doch die Opernregiearbeit wie auch den musikalischen Arbeitsteil unterschätzen, wenn man glaubt, ein Mensch vermöchte beide Arbeitsgebiete völlig zu erschöpfen.«[48]
Aus dieser Wortmeldung kann geschlussfolgert werden, dass Erich H. mindestens seit 1928 Mitglied dieser 1911 gegründeten Berufsvereinigung[49] war, welche die Interessen der Bühnenangehörigen vertrat, die als angestellte Theatervorstände eine Zwischenstufe zwischen Arbeitgebern und Abreitnehmern einnahmen. Ziel und Zweck der VKB waren: „Die Besserung der Gesamtlage ihrer Mitglieder, die Festlegung und Erweiterung ihrer Pflichten und die Hebung des Standes in und außerhalb des Theaters. Ferner beabsichtigte sie die künstlerische und wissenschaftliche Arbeit im Einzelnen zu erleichtern und ihn durch die Verbreitung seiner künstlerischen Ideen und Leistungen zu fördern.“ [50]
6.2. Kölner Opernhaus
Die bedrohte Lage des Essener Stadttheaters könnte Der Grund dafür gewesen sein, dass er trotz seiner dortigen Erfolge ab der Spielzeit 1929/30 an die Städtischen Bühnen Köln wechselte[51]. Für dieses Engagement konnte Erich H. auf seine erfolgreiche Arbeit verweisen und er war sicher nicht mehr auf die Fürsprache eines einflussreichen Dritten angewiesen. Hier erhielt er folgerichtig gleich die Position des Oberspielleiters für das Opernhaus. Daneben war noch Hans Strohbach als Spielleiter angestellt. Intendant war Prof. Max Hofmüller und die oberste musikalische Leitung lag in den Händen von GMD Eugen Szenkar (1891-1977). Gleichzeitig wurden nach Köln verpflichtet: Kapellmeister Fritz Zaun, Ballettmeister Lasar Galpern und Chordirektor Werner Gößling.[52]
Erich H. fand in Köln eine Wohnung im Haus der Familie des verstorbenen jüdischen Rechtsanwalts Justizrat Gustav Sander (1863-1928) in der Josef-Stelzmann-Straße 60. Seine Witwe war die Musikerin, Sozialreformerin und Herausgeberin Klara geb. Loeser (1871-1958). Eine Tochter war die namhafte Innenarchitektin Bertha Sanders (1901-1990). Aber ein näherer Bezug dürfte sich zu deren älteren Schwester Gabriele Sander (1898-1969) ergeben haben, die mit dem Juristen Walter Speyer verheiratet war. Sie war Konzertsängerin und Musiklehrerin. Den beiden Schwestern gelang es mit ihrer Mutter vor Kriegsausbruch nach England zu emigrieren. Im Kölner Adressbuch ist Erich H. von 1930 bis 1932 als „Hirschfeld gen. Hezel“ eingetragen. Es war also dort jedermann möglich nachzulesen, dass Hezel nur ein Künstlername war.
Der Kritiker der Kölnischen Zeitung, Dr. Walther Jacobs, nahm Erich H.s Amtsantritt in Köln durchaus wohlwollend auf:
„Neue Ideen aber bezeugte die Inszenierung, die Erich Hezel (im Verein mit dem Bühnenbildner Heinrich Heckroth) besorgt hatte: Romantik mit neuen unopernhaften Mitteln. Freilich waren die guten künstlerischen Absichten der gespenstigen Vision des Holländerschiffs wenigstens in der Bewegung der Mannschaft noch nicht ganz geglückt.“[53]
Aus Szenkars Erinnerungen[54] muss geschlossen werden, dass sein Verhältnis zum Oberspielleiter wohl eher ein Nichtverhältnis gewesen sein muss. Er erwähnt ihn nämlich mit keinem Wort, wohingegen er sich an die Zusammenarbeit mit Hans Strohbach sehr positiv erinnert. Das ist umso erstaunlicher, weil Eugen Szenkar und Erich H. am 11.10.1930 gemeinsam Alban Bergs „Wozzeck“ zur Aufführung brachten. Diese Inszenierung führte zu antisemitischen Ausfällen, die sich auch gegen Erich H. richteten. Der Westdeutsche Beobachter schrieb:
„Gleichsam noch eine Verbeugung vor Israel (…) Zum Schlusse noch einige Namen zum Aufhorchen: Musik, Alban Berg!, musikalische Leitung. Eugen Szenkar!! Inszenierung: Dr. Erich Hetzel (sic)!!! Bühnenbilder und Kostüme: Panos Aravantinos!!! Bedarf es da noch weiterer Erläuterungen?“[55]
Sollte die zunehmende Zahl an Ausrufezeichen hinter den Namen die Steigerung des Judenhasses verdeutlichen? Man muss nicht zwingend davon ausgehen, dass der Verfasser wirklich Kenntnis von der jüdischen Herkunft der Eltern von Erich H. hatte. Schließlich hatte er auch Alban Berg – wie viel andere vor und nach ihm – wahrheitswidrig zum Juden erklärt. Bemerkenswert auch, dass der Name falsch geschrieben wurde, obwohl er im Programmzettel bestimmt richtig geschrieben war. Wollte er mit „Hetzel“ den Namen sprachlich näher zur Hetze rücken? Ein jüdischer Name ist Hezel jedenfalls genauso wenig wie Berg. Aber auf die Wahrheit kam es diesem Judenhasser mit Sicherheit nicht an. Das der hochbegabte Bühnenbildner Panos Aravantinos (1884-1930) griechische Wurzeln hatte, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Er war an der Berliner Staatsoper engagiert und hatte dort bereits 1925 für die Uraufführung des „Wozzeck“ das Bühnenbild entworfen.
Walther Jacobs schreibt in seiner Besprechung der Aufführung:
„Die Inszenierung des Werks hatte Intendant Hofmüller dem Oberspielleiter Dr. Erich Hezel überlassen, der die Gestalten des Dramas ganz unopernhaft, mit scharfer Naturalistik in Haltung und Gebärde einzeichnete. Die schauspielerische Durchbildung der Sänger (ein andres ist’s mit der gesanglichen) ist ja eine Errungenschaft der neuen Leitung. Wie im Sly waren auch die Wirtshausszenen in der Führung der Menge aufs beste angelegt, die Personen individuell behandelt. Was die schon früher bestellten Dekorationen von Aravantinos betrifft, die dieser auch für Berlin gearbeitet hat, so war Dr. Hezel an sie gebunden und verstärkte in ihnen durch Beleuchtung, durch Schaffung einer Atmosphäre die beabsichtigte malerische Wirkung. Aber die Bilder waren eben meist malerisch, erinnerten eher an niederländische Malerei, anstatt für die grellen Wozzeckstimmungen bezeichnend zu sein, worin Kaspar Neher viel einfacher und treffender war. Bei Aravantinos erscheint der Wozzeck veropert; …
Von den Darstellern – der auch in musikalischer Hinsicht vertreffliche (sic) Chor sei nicht vergessen – ragte Ludwig Weber als Wozzeck hervor, in seiner Gedrücktheit wie in der Wucht. Eine Gestalt, die in allen Äußerungen glaubhaft wirkte, ein Wozzeck dem man die dumpfen Gedanken ablas. …
Der Beifall des besetzten Hauses war schwach, die Oper wird sich erst durchsetzen müssen. Am Schluß erschienen oftmals die Sänger und mit ihnen der Dirigent, der schon vor dem dritten Akt besonders bedankt worden war, und der Spielleiter.“ In seinen Erinnerungen bemerkt Eugen Szenkar im Zusammenhang mit seinem Ruf als „moderner Musiker“ lediglich: „Das ich später den ‚Wozzeck‘ von Alban Berg aufgeführt habe, ist selbstverständlich.“[56]
Der weitaus größere Kölner Theaterskandal – allerdings vor Erich H.‘s Zeit – war 1926 das Verbot weiterer Aufführungen von Bartoks „Der wunderbare Mandarin“ durch den damaligen OBM Konrad Adenauer. Regie hatte hier der von Eugen Szenkar bevorzugte Hans Strohbach geführt.
Erich H. übernahm die Einstudierung zahlreicher weiterer Werke an der Oper, wie die Aufstellung der Inszenierungen in der Anlage deutlich macht. Es ist zweifelhaft, ob Erich H. allerdings hinsichtlich der Programmgestaltung ein wirkliches Mitspracherecht hatte. Eugen Szenkar behielt sich diesbezüglich immer die Entscheidung vor, wie seine Erinnerungen belegen. Aber glücklicherweise stimmten sie in ihrem Interesse der modernen Komponisten grundsätzlich überein und Erich H. war ohne weiteres in der Lage, auch die üblichen Klassiker gemäß seinen Grundsätzen über die Opernregie einzustudieren.
Der Weggang von Erich H. aus Köln könnte seine Ursache in den tiefgreifenden Finanzproblemen des Opernhauses zu suchen sein. Es wurde sogar die Schließung des Opernhauses erwogen. Alle Angestellten waren deshalb über die Fortführung ihrer Verträge im Unklaren. Erst im Mai 1932 wurde die Weiterführung der Kölner Oper beschlossen.[57] Zu diesem Zeitpunkt war es Erich H. bereits gelungen, an der Volksoper Wien ein neues Engagement zu finden. Ein Angebot nach Freiburg als Nachfolger von Oberspieleiter Walter Felsenstein (1901-1975) zu wechseln, nahm er nicht an. Er inszenierte dort aber als Gastregisseur Schillers „Don Carlos“.[58]
In einen Beitrag „Um die Erhaltung der Kölner Oper“ (Kölner Lokal-Anzeiger vom 28.02.1932, S. 15) wird die aufgeheizte antisemitische Stimmung ein Jahr vor der Machtübernahme durch Hitler deutlich:
Ein namenloser Journalist schreibt, daß mehr alte zugkräftige Opern wieder aufgeführt werden. „Weshalb führt man sie nicht hie und da wieder auf? – Weil es den Juden am Theater nicht in dem Kram paßt. Die Presse muß hier energisch eingreifen.“
Ein Musiklehrer schreibt: „Woran liegt es, daß trotz der wertvollen Neuverpflichtungen im künstlerischen Vorstand (Zaun, Gößling, Hezel) immer noch kein Durchschnittsniveau erreicht werden kann, das den Hörer befriedigt?“ Evtl. Mängel der Organisation? Und weiter: „Er (der Intendant) hat etwas, aber nur wenig damit getan, daß er Kräfte wie Zaun, Gößling und Hezel an die Kölner Oper berief, er hat jetzt dafür zu sorgen, daß sie ein Arbeitsfeld und Arbeitsmöglichkeiten bekommen, die ihre Fähigkeiten und ihre Arbeitskraft zum Besten der Kölner Oper voll auswerten.“
Der Duisburger General-Anzeiger vom 19.06.1932, S. 17 verweist auf den Wechsel Erich H. von Köln nach Wien:
„Bekanntlich sind vor einigen Monaten personelle Umstellungen innerhalb des Regiekollegiums des Kölner Opernhauses erfolgt, die dazu geführt haben, daß der bisherige Intendant der Magdeburger Städtischen Bühnen (Egon) Neudegg, dem Kölner Opernhause als Gastregisseur verpflichtet worden ist. Oberregisseur Dr. Hezel wird mit Abschluß der Spielzeit die Kölner Bühne verlassen und einem Ruf an die Wiener Volksoper folgen, die ihn als Oberspielleiter verpflichtet hat.“
6.3. Volksoper Wien
Erich H. hatte bereits seit Herbst 1932 ein Engagement als Oberspielleiter an der Volksoper Wien angenommen[59]. Dort wohnte er bei seiner Patentante Eugenie Demuth in der Favoritenstraße 22. Im Wiener Adressbuch ist er in den Jahren 1932 und 1933 unter seinem amtlichen Namen Erich Hirschfeld eingetragen.[60] In Anbetracht des wachsenden Antisemitismus auch in Österreich dürfte diese Eintragungsform für Erich H. günstiger gewesen sein. So konnte nicht jedermann gleich erkennen, dass Erich Hezel mit dem eingetragenen Erich Hirschfeld identisch ist.
Die Kritik zu den Inszenierungen Hezels an der Volksoper ist durchaus widersprüchlich:
Zu „Die Hochzeit der Sobeide“ heißt es: „in einer recht anständigen, aber nicht eben bejubelten Uraufführung. … Die Volksoper hat sich Mühe gegeben, aber sie war umsonst“ Es werden in der Besprechung[61] keine Namen von Mitwirkenden genannt.
Das blaue Heft, Theaterkunst, Politik, Wirtschaft vom 01.04.1933, S. 25 (Besprechung von L. W. Rochowanski: Wien, Die Hochzeit der Sobeide[62]; Kölnische Zeitung vom 08.04.1933: „armselige, unkünstlerische Inszenierung“, auch hier werden keine Namen von Mitwirkenden genannt
Dortmunder Zeitung vom 22.03.1933, S. 10: „Immerhin bedeutet die Aufführung eine Tat der Volksoper. Dirigent Herbert und Regisseur Herzel (sic!) verdienen volles Lob. Sehr gut die Damen Garda, Leoko, Antosch und Herr Kovacs.
6.4. Stadttheater Teplitz-Schönau
Kurzzeitig war Erich H. als Gast am Stadttheater Töplitz-Schönau tätig. Zeitlich lässt sich dieses Engagement momentan nicht zweifelsfrei einordnen, da es widersprüchliche Angaben gibt. Es soll sich hiernach entweder um die Zeit von September bis Dezember 1933[63] oder um die ersten Monate des Jahres 1934 gehandelt haben. Dieses kurze Gastspiel muss aber nach Hezels Zeit in Wien und vor dem Engagement in Belgrad gelegen haben.
6.5. Nationaltheater Belgrad
Das Schicksal und die künsterlische Tätigkeit hat Feliks Pasic in einem in der Theaterzeitschrift Teatron 2009 publizierten Aufsatz nachgezeichnet. Mit freundlicher Zustimmung der Zeitschrift wird dieser Beitrag in deutscher Übersetzunng von Dorette Wesemann auf dieser Homepage hier veröffentlicht. Deshalb kann auf die Darstellunge dieses letzten Lebensabschnitts zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen hier verzichtet werden.
Letzte Bearbeitung: 16.05.2025
[1] Ausführlich zum Vater: Andrea Lorz, Dr. med. Richard Hirschfeld (1862-1942) praktischer Arzt, Mitbegründer des Verbandes der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), in: Was ist geblieben? Eine Spurensuche zum Leben und Wirken der Leipziger Dr. med. Edgar Alexander, Dr. med. Richard Hirschfeld, Dr. med. Moses Michel Walltuch, Leipzig 2019, S. 40-71.
[2] Lorz, a. a. O., S. 63 f.
[3] Pseudonym: Paul Mongré.
[4] Vgl. Georg Witkowski, Von Menschen und Büchern. Erinnerungen 1863-1933, Leipzig 2003, S. 263 f.
[5] E-Mail von Ellen Bertram vom 20.10.2019.
[6] Ellen Bertram, Leipziger Opfer der Shoah. Ein Gedenkbuch, Leipzig 2015. S. 358 f.
[7] STAL, PP-M 475
[8] So aber Andrea Lorz, a.a.O., S. 68.
[9] Vgl.: https://collections.arolsen-archives.org/archive/1-2-4-1_12410006/?p=1&doc_id=12658723 (24.04.2020)
[10] Seine letzte Wohnanschrift war die Frankfurterstraße 6.
[11] Ihre letzte Wohnanschrift war Nordplatz 7/III.
[12] Richard Hirschfeld in der Grabstätte von seiner Schwägerin Marie Rosenthal und Franziska Hirschfeld im Grab ihrer Eltern. Vgl.: Andrea Lorz, a.a.O. S. 70 f.
[13] Im Weiteren wird der Name mit Erich Hezel verwendet, um Irritationen zu vermeiden.
[14] E-Mail von Edith Markert vom 01.08.2018.
[15] Auskunft des Stadtarchivs Leipzig vom 24.02.2020.
[16] So kolportiert es zumindest Rudolf Mothes in seinen Lebenserinnerungen. Vgl.: https://www.quelle-optimal.de/pdf/Rudolf%20Mothes/rudolf_mothes_erinnerungen_teil_c_pdf.pdf (07.01.2021)
[17] Theodor Fontane schrieb zu dieser Inszenierung eine Kritik. Vgl.: Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen, Nr. 442, vom 22.09.1887, Abendausgabe.
[18] Gemeint ist die Schauspielerin Paula Conrad (1860-1938), die seit 1877 zum Ensemble des Königlichen Schauspielhauses in Berlin gehörte.
[19] Eckhard Ullrich: Fontane sieht „Minna von Barnhelm“, http://www.eckhard-ullrich.de/buecher-buecher/3646-fontane-sieht-minna-von-barnhelm (26.04.2020)
[20] Taufeintrag, Stadtarchiv Braunschweig, Signatur: GIII1 242/206 St. Blasius
[21] Fränkischer Kurier, Nürnberg 25.09.1872, Nr. 92.
[22] Neue Augsburger Zeitung vom 16.04.1886.
[23] Frankfurter Zeitung und Handelsblatt vom 16.04.1886.
[24] Besprechung im Leipziger Tageblatt vom 10.12.1896.
[25] Hans Reimann, Von Kowno nach Bialystok und retour, in: Die Weltbühne 1926, S. 56.
[26] Arthur/Artur Ehrenberg (* 03.04.1901 in Leipzig), Dr. jur. (Leipzig 1926), Sohn des Buchhalters Otto Ehrenberg, studierte 1920-1923 Jura und Cameralia in Leipzig und war später Amtsgerichtsrat in Leipzig. Wohnung: Schwägrichenstraße 13 (bis 1943).
[27] Werner Teupser (1895-1954) wurde Kunsthistoriker und war später der Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig.
[28] Eugen Zadeck war von 1904 bis 1917 als Schauspieler und Regisseur in Leipzig tätig. (Leipziger Tageblatt vom 30.02.1917, S. 2.
[29] Richard Frank Kümmel: Nietzsche und der deutsche Geist, Band II: Ausbreitung und Wirkung des Nietzscheschen Werkes im deutschen Sprachraum vom Todesjahr bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, Berlin 1998, S. 653
[30] Der Historiker Dr. phil. Hellmut Köster war der Sohn des Neurologen Prof. Dr. med. Georg Köster (1867-1932). Seit 1927 war er Assistent am Hamburger Institut für Auswärtige Politik und Kollege von Hans von Dohnanyi. Ab 1939 war K. Lektor des Leipziger Verlags Koehler & Amelang, dessen Verlagsdirektor er von 1946 bis 1950 war. Er war 1946 Stadtverordneter für die CDU und von 1946 bis 1950 Mitglied des Landtages im Freistaat Sachsen. In dieser Position wirkte er an der Formulierung der Verfassung mit. Vgl.: Karl Buchheim, Eine sächsische Lebensgeschichte: Erinnerungen 1889–1972, München 1996. S. 234, 239.
[31] Axel Eggebrecht, Der halbe Weg. Zwischenbilanz einer Epoche, Hamburg 1975.
[32] Eggebrecht, a.a.O., S. 35
[33] Eggebrecht, a.a.O., S. 29
[34] Eggebrecht, a.a.O., S. 35
[35] So schrieb Martin Drucker (1869-1947): „Daß mein Vater von Juden abstammte, erhöhte in eigenartiger Weise meine Selbstachtung.“ Martin Drucker, Lebenserinnerungen, Leipzig 2007, S. 61.
[36] Zitiert nach: Klaus Schuhmann, Leipzig-Transit, Ein literaturgeschichtlicher Streifzug von der Jahrhundertwende bis 1933, Leipzig 2005, S. 170.
[37] Schuhmann, a. a. O., S. 167.
[38] Diesen Hinweis verdanke ich Dorette Wesemann, E-Mail vom 23.01.2020.
[39] Erich Hezel: Opernregie, in: Leipziger Bühnenblätter Nr. 6 1925/26, S. 41 f.
[40] Alle Figuren des Stücks hatten „sprechende“ Namen.
[41] Juristische Wochenschrift vom 01.04.1922, Heft 7, S. 418.
[42] Der „Herr“ war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal acht Jahre alt!
[43] Nachlassakte beim Amtsgericht Leipzig, Aktenzeichen: 2NReg H 2/22.
[44] Deutsches Bühnen-Jahrbuch 1926, S. 330.
[45] Wolf Völker war später Regisseur an der Ostberliner Staatsoper. Nach der Absetzung seiner Inszenierung „Das Verhör des Lukullus“ von Brecht/Dessau verließ er die DDR.
[46] Melos 1928 Heft 7, S. 83 ff.
[47] Neue Musik-Zeitung 1927 Heft 19, S. 429.
[48] Zitiert nach: Die Musik, August 1928, S. 829.
[49] Der erste Vorsitzende war Dr. Carl Heine (1865-1927), Sohn des Hallenser Mathematikprofessors Eduard Heine (1821-1881), der 1895 in Leipzig die Litterarische Gesellschaft mitbegründet und geleitet hatte. Seine Schwester war die Schriftstellerin Anselma Heine (1855-1930). Der Bankier Paul Mendelssohn-Bartholdy (1812-1874) war sein Onkel. Er darf nicht mit dem gleichnamigen Leipziger Industriepionier verwechselt werden.
[50] Heinz Schmitt: Entstehung und Wandlungen der Zielstellungen, der Struktur und der Wirkungen der Berufsverbände, Berlin 1966, S. 200.
[51] Berliner Börsenzeitung vom 27.11.1928, S. 8
[52] Kölnische Zeitung vom 21.11.1928, S. 4
[53] „Die Musik“ vom 03.12.1929
[54] Eugen Szenkar: Mein Weg als Musiker. Erinnerungen eines Dirigenten, Berlin 2014.
[55] Zitiert nach: Elisabeth Bauchhenß, Eugen Szenkar (1891-1977. Ein ungarisch-jüdischer Dirigent schreibt deutsche Operngeschichte, Köln 2016, S. 117
[56] Eugen Szenkar, a.a.O., S. 86
[57] Elisabeth Bauchhenß, a.a.O., S. 125
[58] Karlsruher Zeitung vom 21.06.1932, S. 4
[59] Kölnische Zeitung vom 14.06.1932, S. 9; Duisburger General-Anzeiger vom 19.06.1932, S. 17
[60] Der vor 1933 im Wiener Adressbuch eingetragene Redakteur Erich Hirschfeld, wohnhaft Praterstraße 43, ist wahrscheinlich eine andere Person.
[61] Mitzenauer, Wiener Uraufführung, in: Kölnische Zeitung vom 08.04.1933, S. 2
[62] https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Wolfgang_Rochowanski
[63] Vgl.: https://teplitz-theatre.net/1933-38-mise-en-scene/ (09.02.2020)